 |
Der Schleifertumult in Untenfriedrichstal
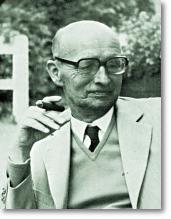 »Bei allem, was zwischen den Kaufleuten und Handwerkern an
lohnpolitischen Gegensätzen stand, beide, Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
hielten zusammen, wenn es um die Erhaltung von Arbeit und Brot ging. Das
zeigte sich damals nicht nur in den gemeinsamen Vorschlägen, den
Auswirkungen der märkisch-preußischen Zollpolitik zu begegnen, sondern
auch an einem Zwischenfall am Untenfriedrichstaler Kotten. Dort hatte
sich 1747 der Schleifer Johann Georg Ern den Kotten gebaut, und zu
einem Wupperkotten gehört ein Deich, eine Schlacht. Er geriet in
Kollision mit dem Inhaber des Fischereirechtes in der Wupper, dem
Freiherren von Westerholt-Gysenberg, dem Haus Nesselrath gehörte. Dieser
ließ die Schlacht einreißen. J. G. Ern fand Unterstützung bei
der Schleiferzunft, und unter Führung von Vogt und Rat zogen viele
Zunftbrüder aus und stellten die Schlacht wieder her. Als sie die Arbeit
beendet hatten, feierten sie am Kotten ein Freudenfest. Der Freiherr sah
die Trotzhandlung als Landfriedensbruch an und holte von Düsseldorf
Soldaten herbei, um die Schlacht wieder zu zerstören. Auf Erns Hilferufe
hin rückten die Handwerksbrüder erneut an, aber als sie die Soldaten am
Kotten sahen, zogen sie ab. Vier Wochen lang dauerten die gerichtlichen
Vernehmungen in Opladen und Burg und behinderten die Arbeit der
Schleifer. Darüber beschwerte sich nicht nur die Schleiferzunft, sondern
alle Solinger Zünfte, auch die privilegierte Kaufmannschaft. Die
Handwerksprivilegien waren von dem Herren von Westerholt-Gysenberg
verletzt, Solinger Handwerker an der Ausübung ihres Berufes gehindert
worden. Energisch drangen die Solinger auf die ihnen vorenthaltene
Bestätigung der Privilegien. Die Regierung ging auf dieses Verlangen
insofern ein, als sie 1751 dem Vizekanzler Sibenius und den Obervogt
Freiherr von Zweiffel mit der Untersuchung beauftragten, ob die
Handwerks-Privilegien bestätigt werden könnten. Die Kommission begann mit
der Arbeit, die sich aber als eine Daueraufgabe herausstellte und bis
1802 noch nicht beendet war. Die an den Vorgängen am
Untenfriedrichstaler Kotten beteiligten Schleifer wurden 1753 zum Teil
schwer bestraft. Indessen befindet sich, dass der Freiherr von
Westerholt-Gysenberg auch nachgeben mußte; der Kotten ist wieder
hergestellt worden, und ein Sohn des einst geschädigten Schleifers
pachtete von dem Freiherren die Fischerei am Untenfriedrichstaler
Kotten. Der Wirbel um die Kottenschlacht war also unnötig gewesen; es
gab eine friedlichere Lösung. Zusammengefaßt bleibt die Erkenntnis, dass
die Sicherung der Arbeit im Solinger Handwerk Vorrang hatte.
»Bei allem, was zwischen den Kaufleuten und Handwerkern an
lohnpolitischen Gegensätzen stand, beide, Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
hielten zusammen, wenn es um die Erhaltung von Arbeit und Brot ging. Das
zeigte sich damals nicht nur in den gemeinsamen Vorschlägen, den
Auswirkungen der märkisch-preußischen Zollpolitik zu begegnen, sondern
auch an einem Zwischenfall am Untenfriedrichstaler Kotten. Dort hatte
sich 1747 der Schleifer Johann Georg Ern den Kotten gebaut, und zu
einem Wupperkotten gehört ein Deich, eine Schlacht. Er geriet in
Kollision mit dem Inhaber des Fischereirechtes in der Wupper, dem
Freiherren von Westerholt-Gysenberg, dem Haus Nesselrath gehörte. Dieser
ließ die Schlacht einreißen. J. G. Ern fand Unterstützung bei
der Schleiferzunft, und unter Führung von Vogt und Rat zogen viele
Zunftbrüder aus und stellten die Schlacht wieder her. Als sie die Arbeit
beendet hatten, feierten sie am Kotten ein Freudenfest. Der Freiherr sah
die Trotzhandlung als Landfriedensbruch an und holte von Düsseldorf
Soldaten herbei, um die Schlacht wieder zu zerstören. Auf Erns Hilferufe
hin rückten die Handwerksbrüder erneut an, aber als sie die Soldaten am
Kotten sahen, zogen sie ab. Vier Wochen lang dauerten die gerichtlichen
Vernehmungen in Opladen und Burg und behinderten die Arbeit der
Schleifer. Darüber beschwerte sich nicht nur die Schleiferzunft, sondern
alle Solinger Zünfte, auch die privilegierte Kaufmannschaft. Die
Handwerksprivilegien waren von dem Herren von Westerholt-Gysenberg
verletzt, Solinger Handwerker an der Ausübung ihres Berufes gehindert
worden. Energisch drangen die Solinger auf die ihnen vorenthaltene
Bestätigung der Privilegien. Die Regierung ging auf dieses Verlangen
insofern ein, als sie 1751 dem Vizekanzler Sibenius und den Obervogt
Freiherr von Zweiffel mit der Untersuchung beauftragten, ob die
Handwerks-Privilegien bestätigt werden könnten. Die Kommission begann mit
der Arbeit, die sich aber als eine Daueraufgabe herausstellte und bis
1802 noch nicht beendet war. Die an den Vorgängen am
Untenfriedrichstaler Kotten beteiligten Schleifer wurden 1753 zum Teil
schwer bestraft. Indessen befindet sich, dass der Freiherr von
Westerholt-Gysenberg auch nachgeben mußte; der Kotten ist wieder
hergestellt worden, und ein Sohn des einst geschädigten Schleifers
pachtete von dem Freiherren die Fischerei am Untenfriedrichstaler
Kotten. Der Wirbel um die Kottenschlacht war also unnötig gewesen; es
gab eine friedlichere Lösung. Zusammengefaßt bleibt die Erkenntnis, dass
die Sicherung der Arbeit im Solinger Handwerk Vorrang hatte.
Hierzu gehört auch der Vorgang von sieben Kaufleuten, die 1749
verhinderten, dass am Kirschberger Kotten, der in der Nähe der
Grunenburg lag, eine Mühle angebaut wurde. Man wollte ihn im Notfall,
d.h., wenn die Kotten auf den kleinen Bächen stillstanden, benutzen
können. Der Kirschberger Kotten scheint verfallen gewesen zu sein. Auf
ihn bezieht sich wohl die am 6.11.1756 erteilte Konzession, die den drei
geschlossenen Handwerken zum Bau von zwei Kotten auf dem Land des
Malteser-Ritterordens erteilt wurde.«
Soweit das umfangreiche Zitat aus Heinz Rosenthal,
Solingen - Geschichte einer Stadt, Band II, Duisburg 1977, Seite 143f.
Diverse Dinge fehlen und viele Fragen bleiben offen: Wann wurde das Wehr zum ersten Mal zerstört? Wann fand das
Freudenfest statt? (Warum habe ich jetzt Asterix und Obelix vor Augen?
Dazu passt auch der Name Freiherr von Zweifel; Ernix gegen Westerholdix:
Das grosse Wehr:-) Wurde die Schlacht ein weiteres Mal durch die
Soldaten zerstört? Warum und wie
wurden die Beteiligten schwer bestraft? Mussten sie in der Wupper baden?
Was hat dieser Vorfall mit den
angeblich den Solinger Handwerkern vorenthaltene Bestätigung der
Privilegien zu tun?
Und den Abschnitt zum Kirschberger Kotten verstehe
ich inhaltlich überhaupt nicht. Wollte sich eine verschworene Anzahl
von Kaufleuten den Standort Kirschberger Kotten sichern?
Wer erteilte die Erlaubnis zum Bau? Und welche Rolle spielten die Malteser?
Mittlerweile habe ich etwas gefunden, worauf Rosenthal möglicherweise
seine Geschichte aufbaut: Schleifertumult Anno 1750
Franz Hendrich führt weitere Urkunden an und schildert die Geschichte
des Kottens etwas anders. Was mag stimmen?
Bei seiner Beschreibung des Hohlenpuhler Kottens meint Hendrichs: Eine spätere
Eintragung aus 1750/51 besagt, dass die Stauanlage, die "Schlacht" auch
"Schlagt" oder endlich, wie es späterhin meist heißt, das "Wehr" zerstört
worden sei und daher keine Abgaben mehr zu entrichten waren.
Im Sohlinger Rhentmeisterey Hebbuch, Jülich-Berg, Amt Solingen heißt es
1750/51: "Joan Georg Erne und dessen Sohn. Dieser Kothen ist per
demolitionem der Schlacht mit ruiniert und der Canon vermög
clementissimi mandati vom 27. Febr. 1751 abgeschrieben."
Besteht die Möglichkeit, dass sich Hendrichs hier mit der Zuordnung der
Fundsache (Quelle: Staatsarchiv, Düsseldorf) vertan hat? Nicht der
Hohenpuhler Kotten ist gemeint, sondern die von Rosenthal geschilderten
Ereignisse rund um den Untenfriedrichstaler Kotten führten zu der
Befreiung von der Abgabe. Oder meint Rosenthal den Hohlenpuhler Kotten?
Der von Rosenthal genannte Name Johann Georg Ern kommt so nicht in der
Urkunde von 1747 vor. Gibt es vielleicht 2 Urkunden? Ich erinnere daran,
dass die beiden genannten Kotten(standorte) nicht weit voneinander entfernt liegen.
Wenn es so sein sollte, was stimmt dann noch?
Schleifertumult, wie wäre es mit noch einer anderen Streitsache: Fischereistreit
|



|
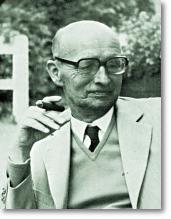 »Bei allem, was zwischen den Kaufleuten und Handwerkern an
lohnpolitischen Gegensätzen stand, beide, Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
hielten zusammen, wenn es um die Erhaltung von Arbeit und Brot ging. Das
zeigte sich damals nicht nur in den gemeinsamen Vorschlägen, den
Auswirkungen der märkisch-preußischen Zollpolitik zu begegnen, sondern
auch an einem Zwischenfall am Untenfriedrichstaler Kotten. Dort hatte
sich
»Bei allem, was zwischen den Kaufleuten und Handwerkern an
lohnpolitischen Gegensätzen stand, beide, Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
hielten zusammen, wenn es um die Erhaltung von Arbeit und Brot ging. Das
zeigte sich damals nicht nur in den gemeinsamen Vorschlägen, den
Auswirkungen der märkisch-preußischen Zollpolitik zu begegnen, sondern
auch an einem Zwischenfall am Untenfriedrichstaler Kotten. Dort hatte
sich